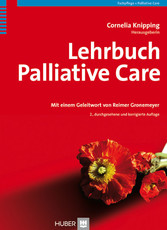
Lehrbuch Palliative Care
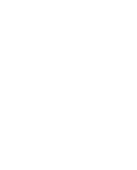
von: Cornelia Knipping
Hogrefe AG, 2007
ISBN: 9783456944609
Sprache: Deutsch
741 Seiten, Download: 22558 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
10.1 Ethik und Palliative Care – Das Gute als Handlungsorientierung (S. 520-521)
Settimio Monteverde
«O Herr, gib jedem seinen eignen Tod. Das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin er Liebe hatte, Sinn und Not. Denn wir sind nur die Schale und das Blatt. Der große Tod, den jeder in sich hat, das ist die Frucht, um die sich alles dreht.» (Rainer Maria Rilke: Das Stundenbuch, 1903)
Abstract
Therapeutisches Handeln angesichts von Sterben und Tod wird durch gesellschaftlich akzeptierte Vorstellungen eines guten Todes normiert. Diese kreisen um die konträren Intuitionen der Leidenslinderung und des Wartenkönnens auf den Tod, welche zentrale Werte des Ethos der Palliative Care bilden. Im Extremfall können sie gegensätzliche therapeutische Implikationen haben, die von der Leidenslinderung unter Inkaufnahme des Todes bis zur Lebenserhaltung um jeden Preis reichen. Einerseits generiert also das Ethos selbst moralische Probleme, so vor allem im Bereich von Sterbehilfen, Sedation und Forschung am Menschen.
Andererseits reflektiert Palliative Care als Zweig der medizinischen Grundversorgung allgemeine Grund- und Zielkonflikte der Medizin. Hier gliedert sich auch Palliation in den medizinethischen Diskurs ein, der in der Mitte des letzten Jahrhunderts als Reaktion auf die Ausweitung der therapeutischen und diagnostischen Möglichkeiten initiiert worden ist und nach den inneren Werten fragt, die ärztliches und pflegerisches Handeln leiten sollen. In den Prinzipien «Autonomie», «Gutes tun», «Nicht schaden» und «Gerechtigkeit» wurden Leitideen solchen Handelns erkannt. Diese fließen in Güterabwägungen ein, mit denen sich die ethische Entscheidungsfindung im klinischen Kontext strukturieren lässt.
Studienziele
Palliative Care wird mit Grundhaltungen assoziiert, die stark auf die moralische Dimension hinweisen, mit denen unsere Kultur dem Thema «Sterben und Tod» begegnet. So ist es nicht verwunderlich, dass den Themen «Ethik» und «Palliative Care» ein hoher Verwandtschaftsgrad zugesprochen wird. Nach Abschluss dieses Kapitels wird die bzw. der Lernende in der Lage sein:
* nachzuvollziehen, dass die medizinethische Reflexion trotz dieser Nähe eigenständig ist und alle Bereiche pflegerischen und ärztlichen Handelns umfasst.
* zu verstehen und nachzuvollziehen, dass für den Kontext der Palliative Care divergierende Vorstellungen eines guten Todes spezifisch sind, welche moralische Probleme generieren können, für die durch eine Abwägung von Gütern und Übeln eine verantwortbare Entscheidungsfindung angestrebt wird.
Schlüsselwörter
Ethik, Ethos, Moral, Intuition, moralische Irritation, Konflikt, Dilemma, «informed consent», Tugend, Kasuistik, ethisches Prinzip, «principlism», Autonomie, Gutes tun, Nicht-Schaden, Gerechtigkeit, Güterabwägung, Menschenwürde, Gesetz der Doppelwirkung, Sterbehilfen, Sedation, Forschungsethik, Risiko-Nutzen-Abwägung
Der gute Tod – Ethos und Ethik in der Palliative Care
Einleitung – Ars vivendi und Ars moriendi
Die berühmten Worte des Dichters Rainer Maria Rilke (1875–1926) aus dem «Stundenbuch» sind ein Ausdruck der Erkenntnis, wie stark die Verfügbarkeit medizinischen Wissens und Könnens die Wahrnehmung von Leben, Sterben und Tod beeinflusst hat. Für den Kritiker Rilke ist es lediglich der kleine Tod, der in den Institutionen der Medizin gestorben wird, der sich einschleicht in die Lücken eines Systems, das sich als blinder diagnostischer und therapeutischer Apparat gebärdet.







