
Menschenrechtsbasierte Pflege - Plädoyer für die Achtung und Anwendung von Menschenrechten in der Pflege
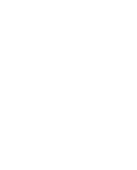
von: Gudrun Piechotta-Henze, Olivia Dibelius
Hogrefe AG, 2020
ISBN: 9783456759135
Sprache: Deutsch
288 Seiten, Download: 5646 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt

Menschenrechtsbasierte Pflege - Plädoyer für die Achtung und Anwendung von Menschenrechten in der Pflege
|13|Geleitwort
Die Vorstellung einer Würde des Menschen ist in theologischen, philosophischen und verfassungsrechtlichen Traditionen überliefert. Sie kommt allen Menschen in gleichem Maße zu und kann nicht verloren gehen oder aberkannt werden. Gleichwohl wird Menschenwürde durch eigene oder durch Handlungen anderer Menschen sowie durch strukturelle Rahmenbedingungen verletzt. Durch Gewalt, aber auch durch Eingriffe in Freiheitsrechte können Menschen derart geschädigt werden, dass „… die nicht bloß dem Ehrliebenden (der auf Achtung anderer Anspruch macht, was ein jeder bloß tun muss) schmerzhafter sind als der Verlust der Güter und des Lebens, sondern auch dem Zuschauer Schamröte abjagen, zu einer Gattung zu gehören, mit der man so verfahren darf.“ (Kant, 1797, zit. nach Ludwig, 2017, S. 111). Was Immanuel Kant in der Zeit der beginnenden Aufklärung zu staatlicher Willkür und unmenschlichen Strafen bemerkte, wurde zum Wegbereiter für die Menschenrechte. Würde ließ sich nicht länger nur als eine Eigenschaft von Menschen auffassen, die sie deshalb besitzen, weil sie Menschen sind. Vielmehr ging es nun auch darum, dass diese Würde das Anrecht verlieh, in einer bestimmten Art und Weise geachtet und behandelt zu werden.
Kants Zitat bekam für mich Anfang der 90-er Jahre des 20. Jahrhunderts eine neue Bedeutung. Pflege kam als Studiengang in unterschiedlichen Formaten an die Hochschulen. Mit der Akademisierung erlebte auch die Ethik in der Pflege einen Aufschwung und wurde zu einem wichtigen, aber nicht unumstrittenen Thema. Pflegende hatten es zu allen Zeiten mit vulnerablen Menschen zu tun, sei es bei Versorgung von Kranken, in der Betreuung von Alten oder in der Begleitung von Sterbenden. Das Berufsethos der Pflege vermittelte eine sensibilisierte Haltung zu asymmetrischen Pflegebeziehungen und übte diese durch Sozialisationsprozesse im Berufsalltag ein. Mit der Akademisierung und der Pflegeethik sollte sich dieser Zugang verändern. Nun galt es, das eigene pflegerische Handeln kritisch in den Blick zu nehmen, es an Maßstäben ethischer Überlegungen und Traditionen zu reflektieren und rechenschaftsfähig insbesondere in Konfliktsituationen zu sein. Ein internalisiertes Pflegeethos konnte dabei zwar eine für den Berufsstand angemessene Handlung hervorbringen, reichte aber für die zunehmend komplexer werdenden Herausforderungen des Gesundheitswesens nicht mehr aus.
Mein Weg führte mich zu dieser Zeit als Ethikprofessorin in einen der neu entstandenen Studiengänge der Pflege, namentlich in die Pflegewissenschaft. In Seminaren und bei Vorlesungen arbeitete ich nun mit Studierenden zusammen, die über hohe Pflegeexpertise und lange Berufspraxis verfügten. Es waren die besten Fachkräfte der Pflege, die die Möglichkeiten eines einschlägigen Studiums mit großem Engagement wahrnahmen. Nur der Zugang in der Pflegeethik gestaltete sich schwierig. Denn schließlich: Was konnte besser sein als eine gefestigte pflegerische Haltung? Über Moral und Ethik wurde nicht diskutiert, denn eine für die Pflege am Menschen angemessene Gesinnung war vorhanden. Oder sie war es halt nicht. Was gab es darüber hinaus zu sagen?
Ein intensiver Austausch über ethische Fragen gelang über das Kant-Zitat. Es brach die Sprachlosigkeit auf. Über Situationen, die Schamröte ins Gesicht treiben, konnten die Studierenden der Pflegewissenschaft reichlich berichten. Obwohl die Geschehnisse z. T. viele Jahre zurück lagen, wurden die Geschichten unter Kopfschütteln, Betroffenheit und Tränen erzählt. Vor dem Hintergrund von Menschenwürde und Menschenrechten war ein intuitives Verständnis von Moral in den geschilder|14|ten Erlebnissen erkennbar, aber auch die Schwierigkeit, Entscheidungen ethisch begründet treffen, Situationen als unangemessen zurückweisen oder sich einer Anordnung verweigern zu können. In einer Geschichte ging es um das Zimmer einer Krebspatientin im fortgeschrittenen Stadium, die vor Schmerzen schrie und die nicht ausreichend therapiert werden konnte. Pflegende mieden in stiller Übereinkunft diesen Raum, wenn es ihnen nur irgendwie möglich war. Eine andere Episode handelte von einer stark übergewichtigen Patientin, die über viele Tage zum allgemeinen Spott auf einer Station wurde. Durch Blicke und Gesten machten sich Pflegende in ihrer Gegenwart lustig. Die Patientin wurde dann in ein anderes Krankenhaus verlegt, weil sich die erhofften Genesungsfortschritte nicht einstellen wollten. An Patient*innen mit apallischem Syndrom wurden in einer Pflegeeinrichtung mit großem Forschungsinteresse, aber ohne eingeholte Einwilligung neue Pflegematerialien „ausprobiert“ und die Ergebnisse für eigene Studien verwertet. In der ambulanten Pflege entstanden am Monatsende Versorgungssituationen, in denen Pflegebedürftigen in ihrer häuslichen Umgebung kein Frühstück gereicht werden konnte, weil aus Geldnot nichts Essbares mehr verfügbar war. Pflegende standen dann vor der Frage, ob sie Nahrungsmittel aus eigenen Vorräten mitbringen oder ob sie eine Behörde mit der Konsequenz informieren sollten, dass daraus weitreichende Veränderungen für das Leben der Betroffenen anstehen könnten. Ausländische Hilfskräfte für die häusliche Betreuung von Patient*innen mit dementiellen Erkrankungen wurden auf Parkplätzen hinter Supermärkten angeworben; sie lebten und arbeiteten dann wochenlang ohne Privatsphäre auf der Ausziehcoach im Wohnzimmer einer mit der Pflege überforderten Familie.
Die Berichte über Verletzungen von Menschenwürde und Menschenrechten sind zahlreich, denn menschenrechtsbasierte Pflege stellt eine dauerhafte Herausforderung in der Pflege dar. Meine Aufgabe in der Pflegeethik war und ist es noch heute, Pflegende mit einer Sprache und mit Denkansätzen vertraut zu machen, die aus der emotionalen Betroffenheit heraushelfen und sie sprach- und handlungsfähig werden lassen. Denn darum geht es: ethische Probleme in schwierigen Situationen wahrzunehmen, sie zu benennen und mit anderen Beteiligten über eine Lösung ins Gespräch zu kommen. Wichtig dabei sind ein reflektierter Standpunkt, der gegebenenfalls auch gegen Widerstände vertreten werden kann, sowie der Mut, beherzt zu handeln. Pflege ist wie kaum eine andere Profession untrennbar mit der Frage verbunden, wie berufsbezogene Situationen menschenwürdig und menschengerecht gestaltet werden können.
Aus der Würde jedes einzelnen Menschen ergeben sich normative Konsequenzen im Blick auf Selbstverpflichtungen und Tugendpflichten gegenüber anderen. Menschen können ihre eigene Würde aufs Spiel setzen durch die Art und Weise, wie sie mit sich selbst oder mit anderen umgehen. Entfremdung von der Arbeit kann beispielsweise dazu führen, dass die Würde in Gefahr gerät. Zur Wahrung der Würde gehört ein „Schutzraum“ für das eigene Leben, in dem eigene Bedürfnisse und Vorstellungen von einem guten Leben umgesetzt werden können. Menschen, die zu Arbeitsmaschinen in der Pflege degradiert werden und sich im ständigen Einsatz befinden, verlieren das Gefühl für das eigene Subjekt sein. In der Gefahr stehen nicht nur Hilfskräfte in ungeschützten Arbeitsverhältnissen, sondern auch Pflegende in Zeiten des Pflegenotstands. Würde entsteht ferner als Tugendpflicht in der Begegnung. Menschen schulden sich gegenseitig Wohlwollen und sollten Formen der Missachtung sowie der üblen Nachrede und Verhöhnung unterlassen, wenn sie die Würde anderer Menschen wahren wollen. Gegen gelegentliche Späße ist nichts einzuwenden. Doch wird über einen Menschen im Zustand von Krankheit als Ganzes gespottet, etwa über sein äußeres Erscheinungsbild, entsteht Ohnmacht und damit Würdeverlust. Die betroffene Person |15|kann sich nicht dagegen wehren. Die auferlegten Tugendpflichten gegenüber anderen Menschen werden somit in grober Weise verletzt, dadurch verlieren diejenige ihre Würde, die so handeln. Dies ruft die bei Kant erwähnte Schamröte hervor.
Aus der Menschenwürde erwachsen auch Rechtspflichten. Sie sind im Ethos der Menschenrechte verankert, einer äußeren Gesetzgebung unterworfen und werden jedem Menschen als natürliches Recht anerkannt. Im politisch-institutionellen Raum eines demokratischen Verfassungsstaates umgesetzt bilden sie ein System koexistierender Freiheiten. Zu Zeiten Kants ging es zunächst darum, Abwehrrechte gegenüber einem übermächtigen Staat zu erwirken. Heute noch kann es für Pflegende in dieser Hinsicht zu konflikthaften Situationen kommen, wenn beispielsweise behandlungsbedürftige Asylbewerber*innen...








