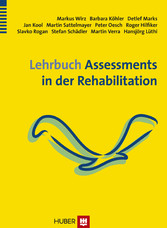
Lehrbuch Assessments in der Rehabilitation
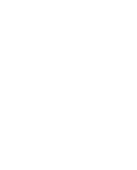
von: Markus Wirz et al.
Hogrefe AG, 2014
ISBN: 9783456952062
Sprache: Deutsch
265 Seiten, Download: 3742 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Zum einen liegt nur für einen Teil der angewendeten Assessments in der Praxis eine Evidenz vor. Zum anderen sind Tests mit sehr guter Evidenz zum Teil oft kostspieliger und aufwändiger in der Anwendung. Als Beispiel müsste man, um eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes sicher zu diagnostizieren, eine Arthroskopie durchführen, was bei einem negativen Ergebnis ein zu großer Eingriff wäre.
Um die Anwendung von Assessements in der Praxis zu erleichtern und deren Leitlinie Aussagekraft zu stärken, kann man Leitlinien zur Hilfe nehmen. Johnston et al. (1992) hat für ihre Benutzung folgende Punkte postuliert:
• Die Praktikabilität bei der Auswahl eines Assessments ist wichtig. Der Aufwand, es anzuschaffen, sowie dessen Schulung und Durchführung darf nicht zu hoch sein.
• Bei der Durchführung sollte man sich immer an die Anleitung halten, denn wenn man eine Änderung aufgrund klinischer Bedürfnisse vornimmt, müsste man die Gütekriterien Validität und Reliabilität neu anpassen. So bekommt das Ergebnis eine andere Bedeutung und Vergleiche mit anderen Patientengruppen sind nicht mehr möglich.
• Kenntnisse über Gütekriterien (vgl. Kap. 5) gehören wie Anatomie und Physiologie zum Basiswissen. Damit Therapeutinnen in jeder Situation das adäquate Assessment wählen und Neuerscheinungen kritisch beurteilen können.
• Das gewählte Assessment muss für das Patientenproblem relevant sein.
• Der Praktiker solle ausgebildet und erfahren in der Durchführung des
2.3 Assessments in der EBP
Assessments sind Messinstrumente, die der qualitativen und quantitativen Registrierung von Schädigung oder Behinderung auf Körperstruktur-, Funktions-, Aktivitätsund Partizipationsebene dienen (Information zur ICF im ICF Kap. 4.). Sie liefern Hinweise für die Diagnostik, die Therapiewirkung und die Prognostik. Diese Tests sollten wenn möglich valide und zuverlässig sein. Des Weiteren dienen Assessments der interprofessionellen Kommunikation und der Kommunikation nach außen, wie zum Beispiel mit den Kostenträgern.
Der Einsatz eines Assessments sollte sich immer an die klinische Fragestellung des Patienten richten. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Gültigkeit vieler Assessments nicht sehr hoch ist. Wie im oben beschriebenen Fall der Mammografie, bringt eine etablierte Untersuchung nicht unbedingt den optimalen Nutzen für die Patientinnen und Patienten.
• Aufwand und Ertrag müssen sich die Waage halten.
• Assessmentergebnisse mit unbekannter Validität, Reliabilität und Respon sivität müssen kritisch beurteilt werden.
Ein wichtiger Punkt, der bei der Auswahl eines Assessmentinstrumentes berücksichtigt werden muss, ist folgender Umstand: Man kann nur das messen, was das Instrument erfasst (Inhaltsvalidität). So kann man z.B. mit einem Dynamometer nur statische, jedoch nicht dynamische Muskelkraft messen.
Assessmentverfahren sind auch Gegenstand der Forschung. Dort werden standardisierte Messverfahren unter anderem zur Quantifizierung von Interventionseffekten benutzt. In jüngster Zeit erfolgt auch vermehrt eine Beurteilung der Assessmentinstrumente selbst, anhand von Gütekriterien. Das Ziel solcher Forschung ist es, das Assessmentinstrument zu prüfen, bevor es in der Praxis zu Anwendung gelangt. Man geht hier der Frage nach, ob der Test in der Lage ist, das zu messen bzw. zu erfassen, was es zu messen vorgibt (Validiät), und ob verschiedene Therapeuten bei dessen Durchführung am gleichen Patienten immer auf das selbe Resultat kommen (Reliabilität). Weiterhin ist zu bedenken, dass etliche Assessments, die in der Forschung angewendet werden, in der Praxis nicht angewendet werden können, da die Anschaffung und der Unterhalt der Testunterlagen und Utensilien zu teuer sind, der Zeitaufwand sehr hoch ist und sich nicht alle Ergebnis-Messungen am Wohle des einzelnen Patienten orientieren.
2.4 Leitlinien
Eine kleine Geschichte zu den Anfängen von Leitlinien. 1954 wurde John Bolam wegen seiner Depression im Friern Krankenhaus behandelt, einer psychiatrischen Klinik in Colney Hatch (England). Als Intervention verordnete sein behandelnder Arzt eine Elektro-Krampf-Therapie. Jedoch erhielt er als Ergänzung keine, wie sonst üblich, Medikamente oder manuelle Techniken zur Muskelentspannung. Zu der damaligen Zeit waren Aufklärungen des Patienten über die Wirkung und Nebenwirkungen der angewendeten Therapiemethode durch den behandelten Mediziner nicht die Norm. John Bolam wurde also nicht aufgeklärt und erlitt aufgrund der aggressiven Elektro-Krampf-Therapie eine Fraktur des Beckens und Luxationen beider Hüftgelenke.
1957 klagte er gegen das Friern Krankenhaus auf Schadensersatz. Sein Anwalt Lord Justice MacNair betonte in diesem Prozess «dass ein Arzt nicht eine veraltete Methode weiter anwenden darf, obwohl sie das Gegenteil der substantiell geltenden Meinung darstellt.» Das ausgesprochene Urteil im oben beschrieben Fall von John Bolam hatte in Großbritannien einen Einfluss auf den medizinischen «Standard». Ab sofort mussten die Mediziner ihr «Tun und Handeln» definieren. Als Grundlage diente die EBM. Schlussendlich ermöglichte die EBM, ganz marginale Interventionen zu legitimieren (Cass, 2006). Von diesem Zeitpunkt an wurde eine Vielzahl nationaler und interner klinischer Leitlinien entwickelt. Leitlinien (englisch guideline) sind systematisch entwickelte Stellungnahmen mit dem Ziel einer Unterstützung im Sinne einer Entscheidungshilfe für Mediziner, Mitglieder anderer Gesundheitsberufe und Patienten, um Diagnosen zu stellen und Maßnahmen für eine angepasste Versorgung anwenden zu können. Man geht davon aus, dass eine gründliche Aufarbeitung des vorhandenen Wissens zu einer objektiven Verarbeitung dieses Wissens führt und somit die entstandene Leitlinie den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Erkenntnisse darstellt. Es werden zwei Arten von Leitlinien unterschieden: die nationale und die interne Leitlinie.
Nationale Leitlinien werden von Fachgesellschaften wie zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) oder sozialrechtlich (z. B. Leitlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 91 SGB V) ausgearbeitet und getragen.
Interne Leitlinien werden z. B. von Krankenhäusern oder einem Verbund von Praxen entwickelt, um die medizinischen Leistungen und organisatorischen Abläufe zu standardisieren.
Das zentrale Ziel einer Leitlinie ist eine inhaltlich und methodisch einheitliche Durchführung von Diagnoseverfahren, medizinischen Entscheidungsprozessen, Interventionen, Erfolgsbeurteilung und Prognosekonzepten beim gleichen medizinischen Problem.
Im Gegensatz zu Leitlinien sind Richtlinien Regelungen, die von einer rechtlich legitimierten Institution aufgestellt wurden. Solche Handlungsregeln werden schriftlich fixiert und veröffentlicht. Diese sind für den Rechtsraum dieser Institution verbindlich, deren Nichtbeachtung zieht definierte Sanktionen nach sich (vgl. Tab. 2-3).







