
Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege - Lehr- und Arbeitsbuch für Pflegende
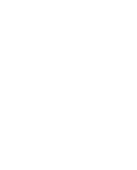
von: Eva?Maria Panfil
Hogrefe AG, 2017
ISBN: 9783456758329
Sprache: Deutsch
492 Seiten, Download: 9999 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
1 Willkommen in der Branche der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Eine Einführung
Eva-Maria Panfil
„Wissenschaftliches Arbeiten“ klingt manchmal sehr geheimnisvoll und kompliziert. Aber eigentlich ist es ganz einfach: Wissenschaftliches Arbeiten ist das Hand- und Kopfwerk der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. So wie die Bäckerin Brot und Brötchen backt und der Friseur Haare schneiden lernt, so lernen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler „Wissen zu entwickeln“. Die Technik zur Wissensentwicklung ist das sogenannte „wissenschaftliche Arbeiten“.
Lernziele
Nach dem Lesen dieses Kapitels sollen Sie folgende Lernziele erreichen:
- die Aufgaben von Wissenschaft und Pflegewissenschaft darstellen können
- Inhalte des wissenschaftlichen Arbeitens erläutern können
- Kompetenzen für das wissenschaftliche Arbeiten beschreiben können
- Kriterien für „Wissenschaftlichkeit“ nennen können.
1.1 Wissenschaft
Die Pflege als Wissenschaft funktioniert prinzipiell so wie alle anderen Wissenschaften. Daher möchte ich Sie zunächst in einer sehr einfachen Form in die allgemeine Welt der Wissenschaften entführen.
Eigentlich beschreibt der Begriff Wissenschaft schon den damit verbundenen Zweck: Es geht darum, Wissen über die Welt, das Funktionieren und Zusammenleben der Menschen zu schaffen. Dabei geht man davon aus, dass es allgemeine Regeln, Gesetze, Phänomene und Verhaltensmuster in unserer Welt gibt (Evers, 1997). Diese sollen durch Forschung entdeckt und untersucht werden.
Jede Einzelwissenschaft wie die Physik, die Soziologie oder die Pflegewissenschaft konzentriert sich auf eine bestimmte Thematik oder ein Fachgebiet, auch als „Gegenstand“ oder „Domäne“ dieser Wissenschaft bezeichnet. Damit entsteht eine Art Arbeitsteilung. Eigenständige Fachgebiete werden auch „Disziplinen“ genannt.
Vereinfacht dargestellt kann man folgende zwei grundlegende „Wissenschaften“ unterscheiden:
- Die Naturwissenschaften wie Biologie, Physik, Mathematik und Chemie beschäftigen sich mit der Frage, was die Welt zusammenhält.
- Die Sozial- und Geisteswissenschaften, z.B. Soziologie, Politik, Philosophie, Geschichte und Sprachen, untersuchen die Kultur des Menschen.
Die Wissenschaft ist auch Gegenstand einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Was Wissenschaft ist und wie sie zu ihren Erkenntnissen kommt, ist beispielsweise Inhalt der sogenannten „Wissenschaftstheorie“. Wie Wissenschaft als sozialer Rahmen aufgebaut ist und wie dieser funktioniert, beschäftigt vor allem die „Wissenschaftssoziologie“. Daneben gibt es die Wissenschaftsgeschichte, die Wissenschaftsethik und die Wissenschaftspolitik.
Eine gute lesbare Einführung in die Wissenschaftstheorie bietet das folgende Standardwerk:
- Chalmers A.F. (2007). Wege der Wissenschaft. Einführung in die Wissenschaftstheorie (6. verbesserte Auflage). Berlin: Springer.
Leider gibt es keine einheitliche Definition von Wissenschaft. Daher soll an dieser Stelle auf eine allgemeine Definition zurückgegriffen werden:
Wissenschaft ist
- „das System des durch Forschung, Lehre und überlieferte Lit.[eratur] gebildeten, geordneten und begründeten, für gesichert erachteten Wissens einer Zeit,
- auch die für seinen Erwerb typ.[ische] methodisch-systematische Forschungs- und Erkenntnisarbeit
- sowie ihr organisatorisch-institutioneller Rahmen“ (Meyers Großes Taschenlexikon, 2006).
Wissenschaft kann also aus drei Perspektiven betrachtet werden.
1.1.1 Perspektive Wissen
Wissen ist der Gegensatz zu Meinungen oder Glauben.
Aufgabe einer Wissenschaft ist gemäß der Definition, Wissen zu bilden, zu begründen, zu ordnen und weiterzugeben.
Die Bildung des Wissens geschieht durch Forschung. Dabei werden bestimmte Methoden, die Forschungsmethoden, angewendet (siehe Abschnitt 1.1.2 Perspektive Forschungs- und Erkenntnisarbeit).
Eine wichtige Regel der Wissenschaft lautet, dass es kein endgültiges Wissen, keine „Wahrheit“ gibt. Das, was wir heute zu wissen glauben, kann morgen schon wieder überholt sein. Vermeintliche „Fakten“ sehen unter dem Licht neuer Forschung anders aus. So wurde beispielsweise dem „Planeten“ Pluto angesichts neuer Entdeckungen im Weltraum und damit einhergehenden Diskussionen 2006 der Status eines Planeten aberkannt. Daher sind Erkenntnisse der Wissenschaften auch nicht in Stein gemeißelt, sondern ständig im Fluss.
Das Wissen einer Wissenschaftsdisziplin, auch „body of knowledge“ genannt, kann man sich wie einen großen Berg von unzähligen verschiedenen Puzzlestücken vorstellen. Die Puzzlestücke stellen die einzelnen Ergebnisse von Studien (Fakten) dar. Darin muss eine Ordnung hergestellt werden, damit dieses Wissen systematisch überblickt werden kann und auch Zusammenhänge sichtbar werden können. Diese Ordnung wird durch Theorien, Konzepte und Klassifikationen hergestellt.
Damit Wissen als solches gelten kann, muss es begründet werden. Dies geschieht unter anderem durch die Verknüpfung mit Theorien und vorhandenen Fakten, durch die adäquate Anwendung der Forschungsmethoden und durch die Kenntnisse der Logik (vgl. Kap. 8).
Wissen muss schließlich auch weitergegeben werden. Dies geschieht vor allem in schriftlicher Form über Publikationen in Zeitschriften und Büchern, aber auch auf Kongressen. Im Rahmen der Lehre wird das Wissen an Lernende weitergegeben.
Verschiedene Arten von Wissen lernen Sie im Abschnitt 1.2.2 kennen.
1.1.2 Perspektive Forschungs- und Erkenntnisarbeit
Jede Wissenschaftsdisziplin hat ihre eigenen Methoden zur Entwicklung von Wissen. Experimente spielen beispielsweise in den Geschichtswissenschaften keine Rolle, während sie in der Physik die klassische Methode sind, um zu neuem Wissen zu gelangen. Wissen kann sowohl durch die theoretische und logische Auseinandersetzung mit Texten und Quellen entstehen als auch durch die Erhebung von Daten aus der beobachtbaren Welt.
Wissenschaftstheoretiker beschäftigen sich seit Jahrhunderten mit der Frage, wie „Erkenntnis“ zu erreichen ist. Dabei wurden innerhalb der Wissenschaften unterschiedliche wissenschaftstheoretische Positionen, die Methodologien, entwickelt. Die Methodologien stehen gleichberechtigt nebeneinander und es gibt keine „richtige“ und vor allem „endgültige“ Position.
Die Naturwissenschaften gehen davon aus, dass es eine „wahre“ Welt gibt und diese mittels unserer Sinne durch Zählen und Messen objektiv erkannt werden kann. Diese Methodologie ist Grundlage der quantitativen Forschungsdesigns. Ziel von Forschung ist es, verallgemeinerbare Ergebnisse zu erzielen.
Die Geistes- und Sozialwissenschaften dagegen bezweifeln die Existenz einer objektiv „wahren“ Welt. Nach ihren Vorstellungen muss der Mensch immer im Zusammenhang mit seiner Lebenswelt gesehen werden. Im Austausch mit der sozialen Welt schreibt der Mensch der Welt Bedeutungen zu, die jedoch der Welt nicht objektiv eigen sind. Deshalb gibt es keine objektive Wahrheit, sondern nur subjektiv und situativ zugewiesene Bedeutungen, d.h. subjektive Wahrheiten. Ziel von Forschung ist deswegen keine Verallgemeinerung der Ergebnisse, sondern bestenfalls die Übertragbarkeit der Befunde auf ähnliche Situationen. Qualitative Forschungsdesigns basieren auf diesen Überlegungen.
Die Pflegewissenschaft nutzt beide Methodologien zum Erkenntnisgewinn.
Eine gut lesbare Einführung zu den beiden Methodologien können Sie folgendem Werk entnehmen:
- Brandenburg, H. & Schrems, B. (2018). Wissenschaftstheoretische Positionen, Designs und Methoden in der Pflegeforschung. In: Brandenburg, H., Mayer, H., Panfil, E. & Schrems, B., Pflegewissenschaft II. Bern: Hogrefe Verlag.
1.1.3 Perspektive organisatorisch-institutioneller Rahmen
Wissenschaft und die dort tätigen Menschen sind in unterschiedlichen Organisationen beheimatet und organisiert. Hochschulen wie Universitäten und Fachhochschulen sind der Ort, an dem klassischerweise Wissenschaft betrieben wird. „Schulen vermitteln Ergebnisse der Wissenschaft. Hochschulen erarbeiten sie.“ (Wagner 2007, 20). Die traditionelle Aufgabe der Universitäten im deutschsprachigen Raum ist es, theoretisches Grundlagenwissen zu erarbeiten, während Fachhochschulen sich auf die Anwendbarkeit des Wissens konzentrieren.
An den Hochschulen wird auch der wissenschaftliche Nachwuchs ausgebildet. Für die Ausbildung gibt es bestimmte Wege über Bachelor, Master, Promotion und teilweise auch noch Habilitation. Daneben gibt es aber auch außeruniversitäre Institute, wie beispielsweise die Max-Planck-Institute, an denen neues Wissen entwickelt wird.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst organisieren sich in bestimmten...









