
Handlungstheorie - Grundelemente des menschlichen Handelns
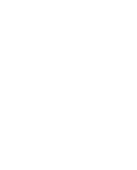
von: Albert Martin
wbg Academic in der Verlag Herder GmbH, 2013
ISBN: 9783534720071
Sprache: Deutsch
248 Seiten, Download: 2042 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
2 Präferenzen
„Doch ich, zu Possenspielen nicht gemacht, noch um zu buhlen mit verliebten Spiegeln … Ich nun, in dieser schlaffen Friedenszeit, weiß keine Lust, die Zeit mir zu vertreiben, als meinen Schatten in der Sonne spähn und meine eigne Mißgestalt erörtern; und darum, weil ich nicht als ein Verliebter kann kürzen diese fein beredten Tage, bin ich gewillt, ein Bösewicht zu sein und feind den eitlen Freuden dieser Tage.“
William Shakespeare, König Richard der Dritte,
Erster Akt, erste Szene
Wer das Handeln eines Menschen verstehen will, fragt zumeist und zuallererst nach den Gründen, die ihn veranlassen, dies oder jenes zu tun oder es eben auch nicht zu tun. Dabei interessieren uns nicht notwendigerweise nur Vernunftgründe – als Ursachen für uns vorderhand unverständliche Handlungen wollen uns diese ohnehin nicht einleuchten – oft sind wir schon damit zufrieden, wenn wir überhaupt ein Motiv erkennen, denn ohne ein Verständnis davon zu gewinnen, was einen Menschen bewegt, können wir auch sein Handeln nicht verstehen. Wir gehen ganz natürlich davon aus, dass menschliches Handeln motiviert ist: irgendetwas muss sein Verhalten antreiben, ihm Richtung und Inhalt geben. Die genaue Bestimmung einer Motivlage ist allerdings nicht ganz einfach, denn das Repertoire menschlicher Antriebskräfte ist sehr groß, es umfasst gleichermaßen Bedürfnisse und Wünsche wie Ziele und Interessen, Absichten, Pläne, Hoffnungen, Sehnsüchte, Träume, Strebungen, Anmutungen, Regungen und Launen, Leidenschaften und Begierden, Drangsale, Ängste, Schrecken, Begeisterung, Spaß und Übermut und vieles mehr, nämlich ganz allgemein all unser Sinnen und Trachten.
Eine bündige Theoriebildung tut sich mit dieser Mannigfaltigkeit naturgemäß schwer. Man behilft sich daher notgedrungen mit Vereinfachungen. Am weitesten geht dabei die Ökonomie, indem sie all das, was der Mensch schätzt und was ihn zum Handeln treibt, unter den Begriff des „Nutzens“ zusammenfasst. Das hat natürlich einen immensen Vorteil, weil man sich nur noch mit der Netto-Wirkung der Motivation zu beschäftigen braucht und sich mit den dahinterliegenden Ursachen nicht mehr näher beschäftigen muss. Und das dynamisch-energetische Element der Motivation wird durch das Nutzenkonzept ebenfalls (sprachlich) gezähmt, weil es die Motivationskraft, die hinter verschiedenen Antrieben steht, mit dem harmlosen Begriff des Nutzenniveaus verblassen lässt. Die Nachteile einer solchen Vereinheitlichung des Motivationsgeschehens sind eigentlich unmittelbar greifbar, sie ebnet die Unterschiede in den Antrieben ein und macht vergessen, dass diese Antriebe auf ganz unterschiedliche Arten das Handeln des Menschen bestimmen. Für die Nutzentheorie ist es gleichgültig, um welches Verhalten es geht – ob um den Kauf von Waschpulver, um die Partnerwahl, das Lesen von Büchern, das politische Engagement – es läuft alles auf eins hinaus, der Maßstab des Handelns ist der Nutzen, der aus dem Handeln entspringt. Gewählt wird die Verhaltensalternative, die den größten Nutzen bringt. In der Abwägung der verschiedenen Nutzengrößen kommen die individuellen Präferenzen zum Ausdruck oder, anders ausgedrückt, die individuellen Präferenzen sagen einem, was man lieber hat und tut: mehr Freizeit oder mehr Lohn, sein Geld für eine größere Anschaffung zusammenhalten oder freigebig ausgeben, um möglichst alle Tage zu genießen, geht man Wandern im Schwarzwald oder zieht es einen in die ferne Welt, wohnt man in der Stadt oder auf dem Land, was macht man mit seinem Geld, mit seiner Zeit, seinen Fähigkeiten und mit seiner Energie? Hinter allem, was man tut, steht eine Nutzenbewertung, genauer gesagt: ein Nutzenvergleich. Der Nutzenvergleich ist notwendig, weil man nicht alles, was einen positiven Nutzen hat, gleichzeitig und in gleichem Maße haben kann und weil man nicht alles, was man will, gleichzeitig und in gleicher Weise tun kann. Im Vergleich der Nutzengrößen, die man durch ein bestimmtes Handeln erreicht (bzw. nicht erreicht) kommen die Präferenzen zur Geltung: Wer lieber faulenzt als sich körperlich ertüchtigt wird keinen Sport machen, wer Status mehr schätzt als Schuldenfreiheit kauft sich eher ein größeres als ein kleineres Auto und so weiter. Positivisten hüten sich allerdings vor dieser Ausdrucksweise. Weil sie sich sehr davor fürchten, über Dinge zu „spekulieren“, die man nicht direkt beobachten kann, machen sie auch keine Aussagen über die Wirkung von Präferenzen (eine psychologische Größe, deren reales Substrat sich eigentlich nicht fassen lässt), sie neigen vielmehr zu der Auffassung, dass die individuellen Präferenzen durch die konkrete Wahl eines Verhaltens lediglich definiert werden. Wesentlich plausibler ist es, an der Vorstellung festzuhalten, dass Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Hoffnungen durchaus real sind, auch wenn sie sich nicht immer und so ohne Weiteres im konkreten Verhalten wiederfinden. Als mentale Kräfte führen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Hoffnungen ein bewegtes Eigenleben, sie machen uns nicht selten ordentlich zu schaffen und nehmen, wenngleich nicht unbedingt geradlinig, auch in einem erheblichen Maß Einfluss auf unser Handeln. Die damit verbundenen metaphysischen Probleme sollen hier aber nicht behandelt werden, vielmehr gehe ich etwas bodenständiger auf die folgenden Fragen ein: Wollen Menschen möglichst viel? Gibt es ein optimales Niveau in der Befriedigung von Bedürfnissen? Wiegt ein Gewinn so viel wie ein Verlust? Sind unsere Wünsche beständig? Wissen wir überhaupt so genau, was wir wollen, jetzt und künftig?
2.1 Mengen
Was wollen Menschen? Alles – und das sofort? Das sagt man zwar manchmal leichthin, in Wirklichkeit glaubt das aber keiner. Oder doch? Ausgerechnet in der Wissenschaft werden manchmal unbestreitbare Selbstverständlichkeiten wie selbstverständlich ignoriert. So findet man in einführenden Ökonomielehrbüchern nicht selten die Behauptung, die Bedürfnisse des Menschen seien grenzenlos (SLOMAN 1991, S. 3; HELMSTEDTER 1991, S. 3; SAMUELSON/NORDHAUS 2007, S. 21). Schon ein klein wenig Nachdenken zeigt, wie absurd eine solche Aussage ist: Ein in buchstäblich jeder Hinsicht beschränktes Wesen sollte alles wollen können, und selbst wenn es ungeheuer viel wollen kann, will es wirklich alles, was es sich so vorstellen kann? Fast den Charakter eines Glaubensartikels besitzt in den ökonomischen Wissenschaften außerdem die Annahme, der höchste Nutzen eines Gutes liege in dessen unverzüglichem Genuss, ein Aufschub der Möglichkeit, das den Gütererwerb motivierende Bedürfnis zu befriedigen, bedinge und rechtfertige jedenfalls eine Abzinsung des Güterwertes:
„Nur wenige Nutzentheoretiker stellen die Annahme in Frage, dass die Menschen bei der Diskontierung des Nutzens genauso verfahren wie die Banken, nämlich dass sie von dem jeweils bei einer gegebenen Verzögerung bestimmten Nutzen für jede zusätzliche Verzögerungseinheit einen gleichbleibenden Anteil abziehen.“ (AINSLIE 2005, S. 140)
Das ist insofern erstaunlich, als man im alltäglichen Leben eher eine Minderschätzung der Gegenwart beobachtet, kaum jemand verharrt im Augenblick und seinem Behagen, man strebt immer nach Zukünftigem, kaum ist die Zukunft dann zur Gegenwart geronnen, hat man schon die neue Zukunft im Visier. Doch darauf, d.h. auf die zeitliche Dynamik des Wünschens und auf die Begrenztheit des Wollens, werde ich erst weiter unten eingehen, zunächst widme ich mich der Frage, wie sehr wir viele Güter wenigen Gütern vorziehen.
2.1.1 Die Goldene Mitte
Will man von allem immer mehr? Die Antwort ist auch hier ein klares Nein. Das wiederum haben Ökonomen schon lange erkannt. Der Privatgelehrte Hermann Heinrich Gossen begründete die Zurückhaltung des Menschen gegenüber dem Immer-mehr erstmalig mit Hilfe einer mathematischen Betrachtung. Wir begnügen uns mit seinen verbalen Ausführungen:
„Die Größe eines und desselben Genusses nimmt, wenn wir mit Bereitung des Genusses ununterbrochen fortfahren, fortwährend ab, bis zuletzt Sättigung eintritt.“ (GOSSEN 1854, S. 4f.)
In der modernen Ökonomie findet diese Einsicht etwas abgewandelt als Gesetz des abnehmenden Ertragsnutzens durchaus eine gewisse (wenngleich nicht durchgängig konsequente) Beachtung. Die Grundidee liegt, wie das Zitat belegt, im Konzept der „Sättigung“ begründet. Natürliche Bedürfnisse (essen, trinken, schlafen usw.) melden, wenn sie unbefriedigt sind, „Alarm“. In diesem Zustand gewinnt alles, was die Bedürfnisse befriedigen kann, naturgemäß eine außerordentlich hohe Wertschätzung, je mehr die Bedürfnisse jedoch „gestillt“ werden, desto mehr verlieren die Güter, die ihrer Befriedigung dienen, an Bedeutung und entsprechend an Wertschätzung. Ist die Ziege satt, mag sie kein Blatt, heißt es treffend. Ist man übersatt, dann erzeugt weitere Nahrungszufuhr sogar Widerwillen bis hin zum Ekel, ein Tatbestand, der in seiner Natürlichkeit bei kleinen Kindern noch gut zu beobachten ist.
Das Zusammenspiel von (fehlender) Sättigung...









